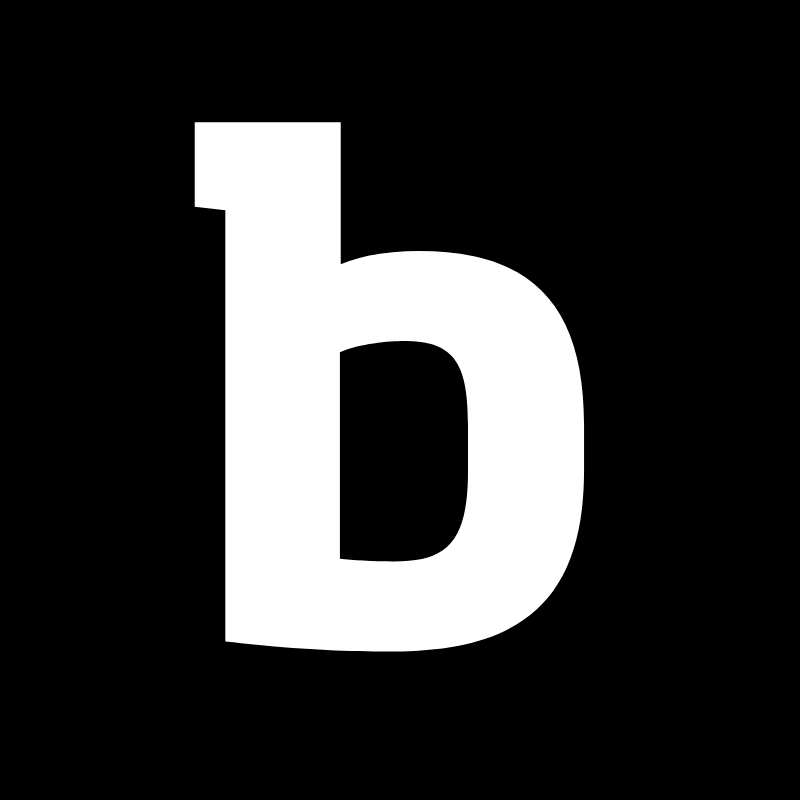Wir leben in einer Zeit von neuer politischer Willkür, auch im Westen. In der westlichen Christenheit werden diese Veränderungen ganz unterschiedlich bewertet. Eine kleine historische Einordnung.
Der ungarische Ministerpräsident bezeichnet Ungarn offen als «christliche Nation». An Weihnachten lässt der US-Präsident Stellungen der Boko Haram angreifen, die in jüngster Zeit wieder Massaker an Christen verüben – in christlichen Kreisen auf Social Media wird dies als Akt des Schutzes der Christenheit gedeutet. In Polen wird das Abtreibungsrecht massiv verschärft mit christlicher Begründung. In den USA werden Geschlechtsidentität und Evolution aus Lehrplänen entfernt und an Unis für entsprechende Forschungen die Gelder gestrichen.
Sollen sich Christen freuen über diese Entwicklungen in der Politik? Und sollte Gleiches auch wieder in der Schweiz geschehen? Ist das Christentum im Westen bedroht und sollte in der Politik dagegen angekämpft werden?
Jäger und Gejagte
In seiner 2000-jährigen Geschichte war die Christenheit schon oft die Gejagte. Man denke zurück an die römische Zeit, als Christen öffentlich verbrannt wurden – zur Belustigung der Massen. Man erinnere sich an die Hugenotten, die in Frankreich aufgrund ihrer protestantischen Konfession verfolgt und vertrieben wurden – viele von ihnen flüchteten in die Schweiz. Oder man sehe nach Nordkorea, wo der Besitz einer Bibel noch heute einem Staatsverrat gleichkommt.
Photo by Anton Kosolapov / Unsplash
In anderen Momenten der Weltgeschichte war das Christentum der Jäger selbst: Sei es in den berühmten Kreuzzügen, Kriege im Namen Gottes. Oder während der Reformation in Zürich, als Zwingli die Täufer aufgrund ihres Bekenntnisses zur Erwachsenentaufe und Kriegsdienstverweigerung in der Limmat ertränken liess – der Reformator wollte die Gunst der Zürcher Stadtherren nicht verspielen. Nicht zu vergessen sind die Hexenverfolgungen, denen unter der Schirmherrschaft von Justiz und Kirche Tausende Frauen und Männer zum Opfer fielen – in der Schweiz wurde mit Anna Göldi die letzte «Hexe» legal 1782 in Glarus verbrannt.
Was haben alle diese Episoden gemeinsam, was unterscheidet sie?
Werden Christen verfolgt, haben sie meist kaum Einfluss auf die Politik und auf Staatsangelegenheiten. Christenverfolgungen resultieren aus einer Verbreitung des Glaubens, der die Macht des Regimes in Frage stellt oder gar bedroht. Verfolgte Christen handeln aus Vertrauen und Ehrfurcht gegenüber Gott.
Werden Christen hingegen zu Verfolgern, haben sie Einfluss auf die Politik und sind verstrickt in Staatsangelegenheiten. Gewaltvolle Christen gibt es dort, wo Nutzniesser einer sozialen Hierarchie ihren Einfluss in der Gesellschaft zu verlieren scheinen oder auszuweiten wissen. Verfolgende Christen handeln aus einer Position der Macht.
Als Fazit könnte man sagen: Der christliche Glaube kann politische Macht bedrohen oder sie stützen. Er bedroht weltliche Macht dort, wo Menschen ihr ungehorsam sind aufgrund ihrer Gottesfurcht – oft auf Kosten des eigenen Lebens. Und er stützt die Macht dort, wo sich Menschen durch ihr Bekenntnis zum Glauben ihren Platz in der Gesellschaft sichern oder verbessern können.
Photo by Konrad Koller / Unsplash
Flucht vor «christlicher» Politik
Wo stehen wir heute? Sind wir in einer Phase der Verfolgung oder in einer Phase der Gewalt? Während diese Frage für Länder wie Afghanistan oder Nordnigeria kaum einer Diskussion wert ist – Christen müssen dort um ihr Leben fürchten – ist die Ausgangslage im «Westen» etwas komplizierter.
Als Anschauungsbeispiel dient die USA, prägend für den Westen und maximal medial präsent. Die US-Regierung um Donald Trump begründet die oben beschriebenen innenpolitischen Massnahmen damit, dass das Christentum bedroht sei durch «linksliberale» Ideologien. Christen würden heute in den USA Verfolgung erfahren für die Ausübung ihres Glaubens. Amerika könne erst wieder aus seiner Krise kommen, wenn es zu seinen christlichen Wurzeln zurückfinde. Doch hier liegt ein ähnliches historisches Problem, wie bereits in einem anderen Artikel zur Situation in der Schweiz dargelegt wurde: Wie christlich war die Politik der ursprünglichen USA?
Ironischerweise flüchteten im 18. und 19. Jahrhundert viele Menschen in die USA aufgrund der christlichen Politik ihrer Regierungen in Europa. Ein Beispiel aus Schweden: Dort gab die lutheranische Staatskirche einen aufgeklärten und liberalen Glauben vor. Als Reaktion flammten verschiedene Erweckungsbewegungen im Land auf. Der Staat, in dem Christen auch in der politischen Verwaltung sassen, sah diese Bewegungen als Bedrohung an und verbot den Austritt aus der Staatskirche. Die Folge war ein riesiger Exodus von Schweden in die USA. Im Inneren der Freiheitsstatue in New York ist auf einer Bronzetafel unter anderem Folgendes zu lesen:
«Behaltet, o alte Lande, euren sagenumwobenen Prunk», ruft sie mit stummen Lippen. «Gebt mir eure Müden, eure Armen, eure geknechteten Massen, die frei zu atmen begehren, ...».
Die Gründungsväter, die meisten theistisch oder agnostisch (also nicht fromm), verstanden den amerikanischen Staat als Gegenmodell zu den europäischen, in denen Religion mit dem Staat verstrickt war. So wurde die Freiheit, also auch das freiheitliche Bestehen von Ideen nebeneinander, in das Grundgesetz aufgenommen mit der Meinungs- und Religionsfreiheit.
Trump spricht also von einem christlichen Amerika, wie es nie existiert hat. Natürlich lässt sich das aufklärerische Freiheitsverständnis auf das jüdisch-christliche Menschenbild zurückführen. Doch die vielen Strömungen des Christentums, die heute in den USA existieren und frei ihre Bekenntnisse ausleben können, verdanken ihr Dasein einer liberalen Grundordnung, die Staat und Kirche trennt.
Nicht von dieser Welt
Nehmen wir diese Geschichte ernst, müssen wir uns davor hüten, dass «Christentum» zur politischen Ideologie wird. Denn so würde es nur dem Zweck dienen, zwischen «uns» und «denen» zu unterscheiden. In diesem Fall wäre das Christentum in politische Machenschaften eingebunden und Jäger, nicht Gejagter.
Damit ist nicht gemeint, dass sich Christen aus der Politik heraushalten sollen. Doch wofür soll der Christ eher in Erinnerung gehalten werden: Dass er stets mit radikaler Härte christliche Positionen vertreten oder dass er mit Wertschätzung gegenüber seinen politischen Gegnern einen Konsens gesucht hat? Schon die Jünger Jesu haben darin ihren Meister lange missverstanden: Das Reich Gottes will nicht durch weltliche Macht forciert werden. Oder wie es Jesus ausgedrückt hat:
Das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun ist aber mein Reich nicht von dieser Erde. Johannes 18;36
Photo by Aaron Burden / Unsplash
Jesus’ Jünger verbreiteten die gute Nachricht nicht mithilfe ihrer politischen Macht, sondern mit praktischer Liebe. Die römischen Statthalter verstanden diese Bewegung nicht, die Menschen aller sozialen Schichten ohne Gewalt dazu brachte, nicht mehr römisch leben zu wollen.
Als das Christentum im 4. Jahrhundert römische Staatsreligion wurde, war es längst in der politischen Elite angekommen. Von nun an waren die Mächtigen als Christen gespalten zwischen ihrer Macht und dem Anspruch Jesu, die andere Wange hinzuhalten. So könnte ihre Reflexionsfrage gelautet haben: «Wenn ich als Christ den christlichen Glauben mit meiner gottgegebenen Macht in der Gesellschaft durchsetze, ist das doch eine gute Sache, oder etwa nicht?» Wer so denkt, muss seine Motive prüfen.
Eine plausible Antwort bieten
Wenn wir beobachten, dass unsere Gesellschaft immer weniger christlich wird, müssen wir uns also die Frage stellen: «Werden wir als Christen wirklich in unserer Freiheit bedrängt oder trauern wir nur einer Gesellschaft nach, in der das Christsein sozialen Status gefestigt hatte?»
Zweifellos gibt es politische Entwicklungen, die der Gottesfurcht widersprechen und dafür sollten wir auch eine politische Stimme sein – gegen die Tötung ungeborenen Lebens oder die Geringschätzung des menschlichen Leibs. Zweifellos braucht es gläubige Menschen, die Gesetze in diese Richtung anstossen. Doch gleichzeitig ist diese politische Frage eigentlich ein Kampf um das Menschen- und Gottesbild. Es stellt sich die Frage: «Wenn die Menschen nicht mehr abtreiben, machen sie das aus Angst vor dem Gesetz oder aus Ehrfurcht vor Gott und Liebe zum Menschen? Können wir Christen eine plausible Antwort bieten, wie das Leben alternativ gelebt werden kann?»
Im Römischen Reich war es normal, ungewollte Neugeborene auszusetzen – Christen haben darauf geantwortet, indem sie eine neue Kultur vorgelebt haben: Sie haben die Ausgestossenen aufgezogen. Die Römer waren nicht beeindruckt von grossartigen Reden und Argumenten, sondern von der liebenden Opferbereitschaft der Christen. Diese Liebe war den Römern schlicht unerklärlich, und übte eine starke Anziehungskraft aus.