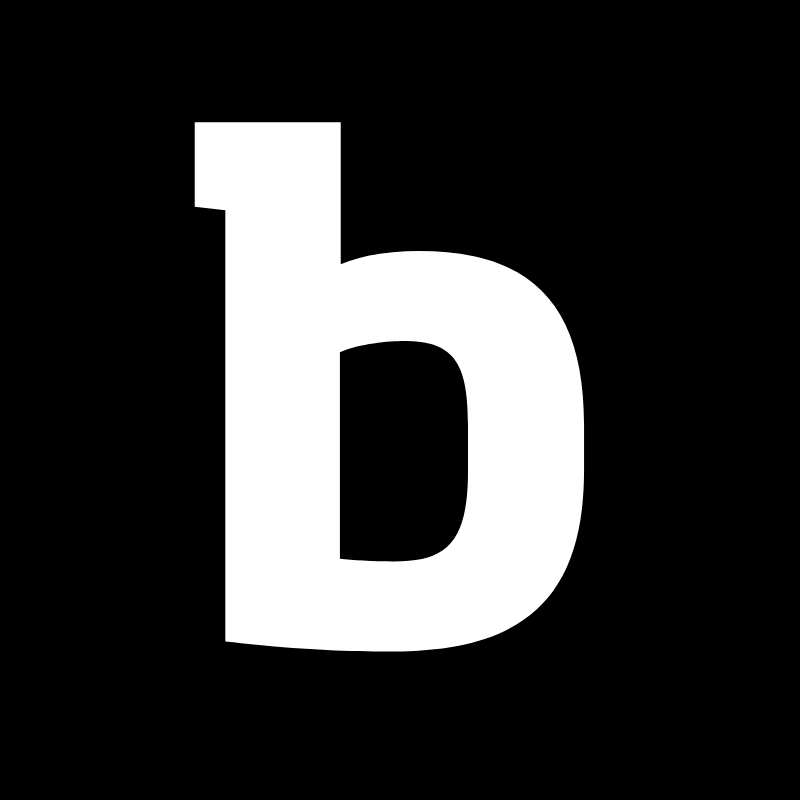Ist die Schweiz ein christliches Land? Hat sie eine christliche Kultur? Und sollen wir wieder zu ihr zurückkehren?
Wir leben in einer Gesellschaft, die sich scheinbar immer mehr von christlichen Werten zu entfernen droht. Entsprechend fällt der Aufruf aus, vor allem in freikirchlichen Kreisen: «Zurück zu den christlichen Wurzeln! Zurück zur christlichen Kultur! Wir sind schliesslich ein ursprünglich christliches Land!»
Damit zusammen hängt ein Geschichtsverständnis von der Schweiz, das in etwa so aussieht: Früher war die Schweizer Nation tief gläubig, das Gebet ehrend und dem Gebot Gottes folgend. Die Frommheit wird bis zum Rütlischwur 1291 zurückdatiert und sowohl das Schweizer Kreuz als auch die Präambel der Bundesverfassung gelten als Beweis ihrer Verbundenheit mit Gott. So habe sich der Segen Gottes auswirken können und der Schweiz fortwährenden Frieden (Neutralität) und Wohlstand beschert. Doch durch eine zunehmende Gottlosigkeit würde in letzter Zeit das christliche Fundament immer mehr untergraben und der Schweiz drohe deswegen der Zerfall.
Tatsächlich lassen sich viele der heutigen politischen Entwicklungen in der Schweiz aus biblischer Sicht kritisieren und die Landeskirche scheint in einer Krise festzustecken. Gleichzeitig stellt sich aus verschiedenen Gründen die Frage, ob ein Zurückbesinnen auf eine «christliche Nation» wirklich das ist, was richtig ist und dem christlichen Glauben – Gott, den Menschen und mir – dient.
Im Folgenden gehe ich auf historische, theologische und philosophische Probleme des Festhaltens an der «christlichen Nation» ein und schlage zum Schluss einen alternativen Weg vor.
Ein uneinig Volk
Die Schweiz scheint das Christentum von Geburt an inhaliert zu haben: Schon auf dem Rütli sollen sie im Namen Gottes geschworen haben, das Schweizer Kreuz und schliesslich auch die Präambel der Bundesverfassung 1848 («Im Namen Gottes des Allmächtigen») deuten auf eine tiefe Verbundenheit mit dem biblischen Gott. In reformierten und freikirchlichen Kreisen wird zudem auf die beiden reformatorischen Bewegungen verwiesen, die auf dem Gebiet der Alten Eidgenossenschaft ihren Anfang genommen haben.
Tatsächlich spielte Letzteres in der Geschichte der Alten Eidgenossenschaft eine grosse Rolle, doch nicht nur zur Erbauung und Ermahnung aller: Fortan kommt es unter den eidgenössischen Ortschaften zu den beiden Lagern «reformiert» und «katholisch», die sich kritisch bis feindselig gegenüberstehen und eine gemeinsame Politik erschweren. Die Kappelerkriege (1529-1531), Villmergerkriege (1656 und 1712) und der Sonderbundskrieg 1847 sind gewaltvolle Höhepunkte eines im Glauben gespaltenen Landes.
Photo by Hansjörg Keller / Unsplash
Am Ende gewinnen diejenigen, welche die Rolle der Kirche im Land eindämmen und den Staat säkularisieren möchten– der Schweizer Bundesstaat entsteht. Auch nach der Staatsgründung wird im sogenannten Kulturkampf die Rolle des Glaubens in der Gesellschaft ausgefochten – ebenfalls mit dem Resultat, dass sich das Land weiter säkularisiert.
Zusammenfassend könnte man also sagen, dass die Verbindung von Glaube und Staat in der Schweiz eher zu einem dauerhaften Zerwürfnis geführt hat, das den Befürwortern der Trennung von Kirche und Staat argumentativ gedient hat.
Die Stündeler kommen
Und doch beginnt die Verfassung von 1848 mit «Im Namen Gottes des Allmächtigen.» Wurzelt die Schweiz also in einer christlichen Kultur? Zweifelsohne gingen die meisten Schweizerinnen und Schweizer im 19. Jahrhundert am Sonntag in die Kirche, lasen vermutlich jeden Tag in der Bibel und beteten vor dem Unterricht vielleicht das Vaterunser.
Doch macht das die christliche Kultur aus? In den Evangelien sind die Pharisäer diejenigen, welche die Gesetze am genausten ein– und die jüdische Kultur in Ehren halten und doch am schärfsten von Jesus kritisiert werden. Theologisch gesehen ist das, was man landläufig als christliche Kultur bezeichnet, geprägt von einem äusseren (moralischen) Handeln, das sich an den göttlichen Geboten orientiert, doch Stolz und Abgrenzung fördert: «Ich handle moralisch richtig, du nicht, wie kannst du nur...?»
Photo by Mark König / Unsplash
Um Missverständnisse vorzubeugen: Gottes Gebote sind wichtig, denn sie ehren Gott und dienen dem Menschen zu einem erfüllten Leben (vgl. Markus 2,23-28). Doch diese Konzentration auf die eigene moralische Handlungsfähigkeit ist Gift für einen Glauben, der sich an das Werk von Christus klammert, uns die hingebende Liebe Gottes offenbart, uns von unserem Leistungsdenken löst und zum barmherzigen Samariter macht.
Dieser Unterschied zwischen innerer und äusserer Frömmigkeit schien in der Schweiz des 19. Jahrhunderts eine Not zu sein: Das zeigt die Entstehung und rasante Verbreitung von freikirchlichen Erneuerungsbewegungen. Ab 1856 kam die Methodistenbewegung in die Schweiz, die an einer Erweckung zu einem lebendigen Glauben und tatkräftiger Nächstenliebe arbeitete. Ab 1869 gründeten Missionare von St. Chrischona überall in der Schweiz Gemeinden, angetrieben davon, die Botschaft von Jesus zu verkünden. Die Heilsarmee nahm sich ab 1882 sozialer Randgruppen an. Und die Pfingstbewegung ab 1906 wünschte sich die Ausgiessung des Heiligen Geistes.
Photo by Mateus Campos Felipe / Unsplash
Alle genannten Bewegungen reagierten auf ein ungestilltes Bedürfnis und wurden gleichzeitig in der Schweizer Gesellschaft und von der Landeskirche geächtet, marginalisiert und zum Teil sogar verboten – der Begriff «Stündeler» erinnert heute noch daran.
Die heutigen Freikirchenbewegungen sind also Folge und Reaktion auf eine Schweiz, die als zu wenig christlich angesehen wurde – damals schon, nicht erst im 21. Jahrhundert. Es hat zu keiner Zeit eine Schweiz gegeben, die «gesättigt» war von einem «lebendigen» Glauben nach freikirchlich-evangelikalem Verständnis.
De civitas dei
Schliesslich bleibt die philosophische Frage, ob ein Staat überhaupt einem Christen gleich – also ein Jesusnachfolger - sein kann.
Schon der antike Kirchenvater Augustinus stellt sich diese Frage in seiner einflussreichen Schrift «De Civitas dei», zu deutsch «Der Gottesstaat». Er kritisiert antike Autoren wie Cicero, welche den römischen Staat verherrlichen und unterscheidet zwei Reiche:
- Der Gottesstaat, der nicht sichtbar als Institution aus denjenigen besteht, die Gott lieben. Sein Ziel ist die Gemeinschaft mit Gott und seine Vollendung komme erst im Himmel.
- Der irdische Staat, der Ordnung, Frieden und irdisches Wohl zum Ziel hat, ist notwendig wegen der gefallenen Natur des Menschen und kann vielleicht Gutes leisten, ist jedoch vergänglich.
Photo by Daniel Lincoln / Unsplash
Der Mensch ist Teil beider «Staaten». Augustinus akzeptiert die weltliche Autorität, um Frieden und Ordnung zu sichern, vertraut ihm aber nicht das Heil an, das alleine bei Gott liegt. Er fordert, dass Christen gute Bürger beider Staaten sind, aber ohne den Anspruch, den irdischen Staat zu verchristlichen.
Augustinus legt also die Betonung darauf, dass der irdische Staat nicht «christlich» sein kann, sondern von Christen positiv beeinflusst werden soll.
Der Wolke der Schweizer Zeugen folgen
Das alles zeigt, dass wir die historische Schweiz nostalgisch verklären, wenn wir sie uns als eine «christliche Nation» zurückwünschen. Das gesellschaftliche Klima ändert sich nicht mit der Befolgung von moralischen Regeln, mit der Rückbesinnung auf Geschichte und Symbole.
Stattdessen sollten wir Christen uns auf die Pflege einer aktiven Gottesbeziehung konzentrieren und unsere Anliegen, Werte und Handlungen an seiner Gnade für uns messen. Dann werden wir, anstatt über den Wertezerfall zu klagen, kreative Wege finden, unserer Gesellschaft zu dienen – christusähnlich.
Und dafür lohnt es sich auf jeden Fall, einen Blick in die Schweizer Geschichte zu werfen, sie ist voll mit Zeugen für solche Wege: Der Emerit Niklaus von Flüe beriet die eidgenössische Tagsatzung zur Bewahrung des Friedens, Heinrich Pestalozzi reformierte die Bildung durch seinen Glauben an das christliche Menschenbild, Johanna Spyri drückte in ihren Büchern die tiefe christliche Grundhaltung von Vergebung und Vertrauen auf Gott aus, Theodor Fliedner begründete die Diakonissenbewegung und setzte sich für soziale Hilfe ein und die Lehrerin Elisabeth Eidenbenz rettete über 600 Schwangere und Kinder aus christlicher Nächstenliebe - um nur ein paar Beispiele zu nennen.
Was hältst du von diesem Artikel? Bist du einverstanden oder siehst du etwas anders? Schreib mir deine Meinung!